Dr. Ebru Yildiz ist eine der profiliertesten Stimmen für interkulturelle Kommunikation im deutschen Gesundheitswesen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie und leitet das Transplantationszentrum der Universitätsmedizin Essen. Zusätzlich engagiert sie sich als Mentorin für Frauen im Gesundheitswesen. Was sie besonders auszeichnet: Sie hat ihre Karriere in der Pflege begonnen – ein Weg, der sie gelehrt hat, Medizin aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen. In dieser Podcastfolge spricht sie mit Inga Bergen über strukturelle Barrieren, Chancen für mehr Vertrauen in der medizinischen Versorgung und den Unterschied zwischen „medizinisch versorgen“ und „gesund leben lassen“.
Der Weg vom Pflegeberuf zur ärztlichen Leitung
Dr. Ebru Yildiz beginnt ihre berufliche Laufbahn in der Pflege, während sie parallel ihr Medizinstudium abschließt. Diese Erfahrung prägt ihren heutigen Führungsstil und ihr Verständnis für Teamarbeit im Klinikalltag. Sie weiß, wie es ist, auf der Seite der Assistenz zu stehen – und erkennt die strukturellen Hürden, denen sich insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund stellen müssen. Diese Perspektive macht sie zu einer Fürsprecherin für mehr Durchlässigkeit in der Gesundheitsbranche.
Warum Kommunikation der Schlüssel ist – und oft scheitert
Ein zentrales Thema im Gespräch ist die Rolle der Kommunikation zwischen Ärzt:innen und Patient:innen. Dr. Ebru Yildiz macht deutlich, dass viele Missverständnisse im klinischen Alltag nicht medizinischen, sondern kulturellen Ursprungs sind. Sprache sei dabei nur ein Aspekt – viele Patient:innen verstünden beispielsweise das Konzept von Organspende nicht oder hätten kulturell geprägte Vorstellungen von Tod, Körper und Familie, die mit dem medizinischen System kollidieren. Sie fordert daher ein systematisches Training in kultursensibler Kommunikation – für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen.
Organspende: Wenn Vertrauen fehlt, hilft keine Aufklärung
Als Leiterin eines Transplantationszentrums erlebt Dr. Ebru Yildiz täglich, wie schwierig es ist, über Organspende zu sprechen – insbesondere in Familien mit Migrationsgeschichte. Nicht, weil diese ablehnend wären, sondern weil Vertrauen fehle. Wer schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gemacht habe oder sich nicht gesehen fühle, wird sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen, die so tief ins eigene Leben und in den Körper eingreifen. Sie plädiert für mehr kulturelle Übersetzungsarbeit, um Ängste abzubauen und Räume für echte Gespräche zu schaffen.
Warum sie für „gesunde Lebensjahre“ kämpft – nicht nur für medizinische Versorgung
Dr. Ebru Yildiz unterscheidet klar zwischen Medizin und Gesundheit. Während das medizinische System häufig auf Krankheit reagiere, brauche es einen Paradigmenwechsel hin zur Förderung gesunder Lebensjahre. Dabei gehe es nicht nur um Prävention, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe, Bildung, Ernährung und Arbeitsbedingungen – also um die sozialen Determinanten von Gesundheit. Besonders betroffen von ungerechten Gesundheitschancen seien Frauen, Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status und jene mit Migrationsgeschichte.
Vertrauen, Haltung und Kommunikation auf Augenhöhe
Dr. Ebru Yildiz betont im Gespräch mehrfach, dass Vertrauen die wichtigste Währung in der Medizin ist – besonders bei sensiblen Themen wie Organspende, Transplantation oder chronischer Erkrankung. Sie schildert, wie entscheidend es ist, Patient*innen auf Augenhöhe zu begegnen und eine Sprache zu finden, die nicht ausgrenzt, sondern einbindet. Dabei geht es ihr nicht nur um sprachliche Barrieren, sondern auch um kulturelle, soziale und emotionale Unterschiede. Als Beispiel nennt sie, wie auch gesundheitliche Kommunikation über Social Media neue Wege geht – und verweist auf Formate wie „Fit Dad Hendrik“, die niedrigschwellig Wissen vermitteln und dabei diverse Zielgruppen erreichen. Solche Initiativen zeigen, wie moderne Gesundheitskommunikation auch außerhalb klassischer medizinischer Kontexte funktionieren kann – nahbar, authentisch und lebensnah.
Interkulturelle Medizin ist mehr als Diversity-Tag
Gegen Ende des Gesprächs warnt Dr. Ebru Yildiz vor oberflächlichen Diversity-Initiativen. Für sie ist interkulturelle Medizin keine PR-Maßnahme, sondern ein struktureller Umbau: medizinische Versorgung muss konsequent auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Gesellschaft ausgerichtet werden. Das heißt: Dolmetscherstrukturen, mehrsprachige Aufklärung, divers zusammengesetzte Teams und Entscheidungsfindung, die kulturelle Konzepte mitdenkt. Nur so könne Vertrauen entstehen – und echte Wirksamkeit.
Unterschied von Herkunft und Haltung
Im gesamten Gespräch wird deutlich: Für Dr. Ebru Yildiz bedeutet interkulturelle Medizin nicht, Menschen nach ihrer Herkunft zu sortieren. Vielmehr gehe es darum, Haltung zu zeigen – eine Haltung, die offen, lernbereit und respektvoll ist. Medizin darf nicht nach Schema F funktionieren, sondern muss individuell und kontextsensibel sein.
Ebru Yildiz fordert: Mehr Menschlichkeit, mehr Struktur, mehr Verständnis
Diese Podcastfolge mit Dr. Ebru Yildiz zeigt eindrücklich, wie wichtig kulturelle Kompetenz im Gesundheitswesen ist – und dass es nicht reicht, Wissen zu vermitteln. Es braucht Haltung, strukturelle Veränderungen und eine Medizin, die Kommunikation und Vertrauen in den Mittelpunkt stellt. Wer mehr über Organspende, interkulturelle Kommunikation, Gesundheitsgerechtigkeit und den persönlichen Weg einer beeindruckenden Ärztin erfahren möchte, sollte unbedingt reinhören.
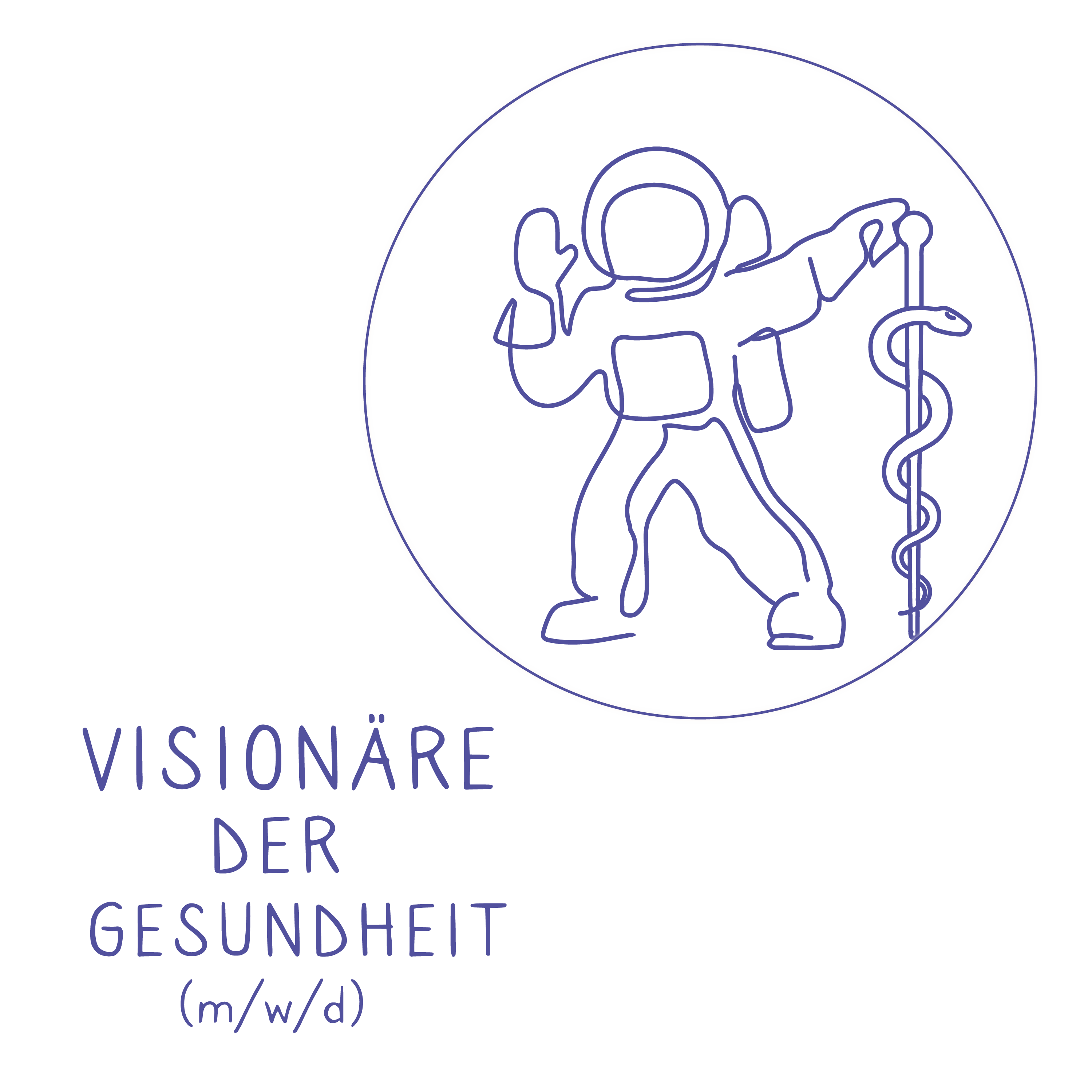

Schreibe einen Kommentar